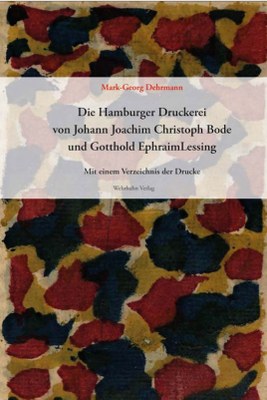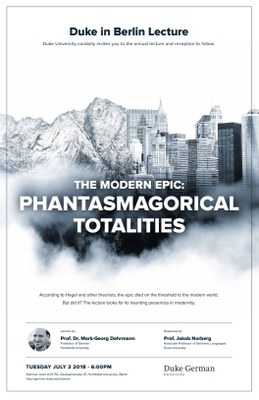Aktuelles
Erschienen im Herbst 2025
Zeitschrift für Germanistik, NF XXXV (2025), H. 3
Schwerpunkt: Lyrische Zyklen
Hrsg. gemeinsam mit Olga Katharina Schwarz und Michael Woll
Open Access
In Vorbereitung (Frühjahr 2026) ist ein weiterer Band zur zyklischen Formation des Sonettenkranzes in der deutschsprachigen Literatur (hg. gem. mit Olga Katharina Schwarz und Johannes Schmidt).
Das Programm der Tagung aus dem Oktober 2024 siehe
hier
Erschienen im Oktober 2023
Zarathustra-Lektüren
Hg. gemeinsam mit Christoph König
344 Seiten, Hardcover
Schwabe Verlag Basel
Also sprach Zarathustra ist bis heute ein schwieriges, ein rätselhaftes und erstaunliches Buch. Die hier vorgelegte «lecture à plusieurs» geht von der Entfaltung der Kreativität in den Kapiteln und der Komposition des Ganzen aus. Sie gewinnt das Verständnis konkret und objektiviert es in der gemeinsamen Kritik. Damit tritt die in der Forschung eingebürgerte Dichotomie von Philosophie und Literaturwissenschaft in den Hintergrund; vor allem geht es um die beständige, philologische Reflexivität, die erst möglich macht, dass Nietzsches Denken sich entschieden sprachlich vollzieht. Die Lektüren sind nach Hauptfragen gebündelt, die das Werk aufwirft: der Lehre als Textpraxis, der Buchgenese und Werkpolitik, den Forschungstopoi, der dreifachen Vernunft von Philosophie, Poesie und Philologie, der Idiomatik, Komposition und Vielfalt an Gattungen, der Autoreflexion und dem produktiven Umgang mit den Traditionen
Die Drei Fragezeichen
Ein Gespräch vom 25.1.2023 auf Deutschlandradio Kultur mit Ramona Westhof zu dem neuen Drei ???-Film "Der Fluch des Drachen" .
Der Humanismus und seine Künste
Hrsg. gemeinsam mit Martin Vöhler
Heidelberg: Winter, 2021.
Bd. 2 der Reihe "Humanismus und Antikerezeption im 18. Jahrhundert", hrsg. von Hubert Cancik und Martin Vöhler
Mit Beiträgen von Martin Vöhler, Mark-Georg Dehrmann, Alfred Schäfer, Joachim Rees, Constanze Baum, Timm Reimers, Frédéric Döhl, Hubert Cancik, Sotera Fornaro, Eva Kocziszky, Johannes Schmidt, Helmut Hühn, Lorella Bosco, Pascal Weitmann, Jörn Rüsen
Gegenüber den älteren Humanismen zeichnet sich der europäische Humanismus im 18. Jahrhundert durch eine starke Erweiterung der Materialbasis aus. Die unmittelbare, dingliche und nicht mehr vorrangig textgebundene Kenntnis der Antike wird nachhaltig befördert. Zahlreiche Ausgrabungen wie in Herkulaneum und Pompeji eröffnen neue Zugangsmöglichkeiten. In den neu entstehenden Sammlungen wie auch in der zeitgenössischen Malerei, Plastik und Architektur gewinnt die Antike ein hohes Maß an Anschaulichkeit.
Gerade die materiellen Funde führen maßgeblich zur Idealisierung antiker Humanität, der aber sehr bald auch markante Entidealisierungen gegenübergestellt werden. Welche Rolle spielen die neuen Funde und Befunde in den verschiedenen Künsten? Wo liegen die Grenzen des humanistischen Menschenbildes und seiner künstlerischen Formationen? Was wird ausgeschlossen und verdrängt? Welche Erkenntnisleistung kommt dabei den verschiedenen Künsten und Künstlern zu?
Erschienen im Herbst 2020
Zeitschrift für Germanistik, NF XXX (2020), H. 3
Schwerpunkt: Große Formen. Ästhetik und Epistemologie des extensiven Schreibens
Hrsg. gemeinsam mit Svetlana Efimova
MARK-GEORG DEHRMANN, SVETLANA EFIMOVA
Große Formen. Ästhetik und Epistemologie des extensiven Schreibens. Vorwort
MARK-GEORG DEHRMANN
Episode und Totalität.
Zur Poetik des modernen Epos nach 1800, am Beispiel von Friedrich Schlegel
SVETLANA EFIMOVA
Die Vermessung des Schreibens.
Navid Kermanis „Dein Name“ als Poetologie der Großform
NICOLA GLAUBITZ
Zeit, Affekt und lange Form.
David Foster Wallace und Karl Ove Knausgård
MAXIMILIAN MENGERINGHAUS
Die These vom langen Gedicht.
Walter Höllerer und das deutschsprachige Langgedicht
MONA KÖRTE
Widerstand gegen die große Form.
Patrick Modianos Romane in Untergröße
BERNHARD METZ
Zur (Un-)Edierbarkeit großer Formen.
Über unmögliche Editionsprojekte
Erschienen im Mai 2020
Monographie
Die Hamburger Druckerei von Johann Joachim Christoph Bode (1767–1778) und Gotthold Ephraim Lessing (1767–1769). Mit einem Verzeichnis der Drucke
412 Seiten, 141 Abb., Hardcover
Wehrhahn Verlag Hannover
1766 kaufte Johann Joachim Christoph Bode – berühmter Übersetzer und Freimaurer – in Hamburg eine Druckerei. Gotthold Ephraim Lessing wurde kurz darauf Teilhaber. Ihr ökonomisches Joint Venture fiel nicht zufällig mit dem Beginn der Hamburger ‚Theaterentreprise‘ zusammen: Bode und Lessing stellten die Drucksachen des Theaters her, allen voran die Hamburgische Dramaturgie und die Theaterzettel. Aber ihre Ambitionen gingen weiter: Sie wollten dem herkömmlichen Buchhandel alternative Geschäftsmodelle entgegensetzen, die es Autoren ermöglichen sollten, von ihrem Schreiben zu leben. Zwar zog sich Lessing 1768 enttäuscht wieder zurück. Bode jedoch führte die Druckerei bis 1778 in diesem Sinne weiter.
Hier entstanden zentrale Werke dieser Zeit, so etwa Lessings antiquarische Briefe (1768), Gerstenbergs Ugolino (1767), Basedows Elementarwerk (1768-70), Klopstocks Hermanns Schlacht (1768), Oden (1771) und Gelehrtenrepublik (1774), Herders Von deutscher Art und Kunst (1773) oder Bodes des Tristram Shandy (1774). In vielen Projekten manifestieren sich die zeitgenössischen Umstellungen in Verständnis und Geltungsanspruch von literarischer Autorschaft. An den gelehrten Netzwerken, in die die Druckerei eingebunden ist, zeigt sich: Zur literarischen Autorschaft gehörte in dieser Zeit die Bereitschaft, ökonomische Experimente einzugehen.
Die Publikation rekonstruiert erstmals umfassend die ungewöhnliche Hamburger Unternehmung. Sie bietet einen monographischen Teil zu ihrer Geschichte und zentralen Projekten, ein vollständiges, kommentiertes Verzeichnis aller Drucke sowie 140 Abbildungen.
Erschienen im April 2019:
Zeitschrift für Germanistik, NF XXIX (2019), H. 2
Schwerpunkt: Transnationale Lektüren in Europa. 1800—1850
Hrsg. gemeinsam mit Johannes Schmidt
MARK-GEORG DEHRMANN, JOHANNES SCHMIDT
Transnationale Lektüren in Europa.
1800–1850.
Vorwort
STEFAN KNÖDLER
Initialzündung der europäischen Romantik.
Zur frühesten Rezeption von August Wilhelm Schlegels Vorlesungen „Ueber dramatische Kunst und Litteratur“ im Kreis von Coppet sowie bei Stendhal und Charles Nodier
JOHANNES SCHMIDT
Im Rhythmus der Nation.
Metrik und Nationalismus im 19. Jahrhundert
MARK-GEORG DEHRMANN
Galerie der Volksgeister.
Zum europäischen Diskurs des ‚Nationalepos‘ im 19. Jahrhundert
HÉCTOR CANAL
„Unterhändler ausländischer Dichter“.
Johann Diederich Gries’ Calderón-Übersetzungen
ALFRED GALL
Ein Pilger auf Wanderschaft:
Europäische Wirkungen von Adam Mickiewiczs romantischem Messianismus
BRIGITTE HEYMANN
Victor Hugo.
Geopoesis der europäischen Literatur
Duke Lecture am 20. Juni 2018 zum Epos in der Moderne:
Phantasmagorical Totalities
Erschienen im Mai 2018:
Prekär: Der germanistische ‚Nachwuchs‘ an deutschen Universitäten. Berichte, Positionen, Konzepte
Heft 2/2018 der Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes
Hrsg. von Mark-Georg Dehrmann und Albrecht Hausmann
Die Wissenschaft in Deutschland zum Beruf machen zu wollen, bedeutet, unplanbare, lange Karrierewege zu beschreiten und dabei oft prekäre Arbeitsbedingungen in Kauf zu nehmen – um irgendwann, vielleicht und mit viel Fortune, auf einer der raren Professuren anzukommen. Aus guten Gründen sind die universitären Karrierestrukturen daher seit längerem Gegenstand kritischer Debatten und vermehrt auch engagierten Protestes. Das Heft der MDGV teilt dezidiert das Unbehagen an den Arbeitsbedingungen und Karrierestrukturen in der Wissenschaft. Es möchte sich in die Debatten einschalten, gleichzeitig aber auch verschiedene Positionen dokumentieren und so die Kontroversen stimulieren. Wir haben daher verschiedene Persönlichkeiten und Akteure aufgefordert, in kurzen Texten zu zentralen Themen wie dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dem Modell Juniorprofessur bzw. Tenure-Track-Professur und Gleichstellung Position zu beziehen. Daneben sondiert das Heft, wie entsprechende Karrierewege in anderen Ländern verlaufen.
Die Einleitung von Albrecht Hausmann und Mark-Georg Dehrmann finden Sie unter www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com.
Brockes-Lektüren - Ästhetik, Religion, Politik
Tagung an der Humboldt-Universität zu Berlin
26. bis 28. März 2018
Unter den Linden 6 (Hauptgebäude)
Raum 2070a
Die Tagung möchte gegenüber früheren übergreifenden Einordnungen von Brockes’ Werk einen Schritt zurücktreten. Sie schlägt vor, sich zunächst intensiver auf die außerordentliche Komplexität der Texte einzulassen und sie präziser auf ihre historischen und kulturellen Kontexte zu beziehen – vor dem Hintergrund deutschsprachiger und europäischer Dichtungstraditionen sowie lokaler Hamburger und norddeutscher Konstellationen.
Eingehende Lektüren sollen Fragen nachgehen, die Brockes’ Werk auf ganz besondere, gleichzeitig aber auch epochal aufschlussreiche Weise prägen. Wie setzt sich seine spezifische ästhetisch-theologische Herangehensweise im konkreten Gedicht um? Wie weit reicht seine Aufwertung der Sinneserfahrung und welche Grenzen hat Brockes’ Empirismus? Auf welche Weise positioniert sich seine Dichtung zur christlichen Offenbarung, nicht zuletzt in biblischen Referenzen oder im Gebrauch emblematischer Bildlichkeit? Welche Funktionen haben die musikalischen Gattungen im ‚Irdischen Vergnügen in Gott‘? Und wie partizipieren die Gedichte an Themen, Rhetorik und Lektüremodus zeitgenössischer Erbauungsliteratur?
Detailliertes Programm und Flyer als PDF anzeigen
Veranstaltet von
Mark-Georg Dehrmann und Friederike Felicitas Günther
Nach der Theorie, jenseits von Bologna, nach der Exzellenz? Perspektiven der Germanistik im 21. Jahrhundert.
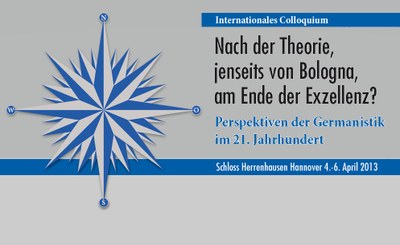
Vom 4. bis 6. April 2013 fand im Schloss Herrenhausen (Hannover) das Colloquium „Nach der Theorie, jenseits von Bologna, am Ende der Exzellenz? Perspektiven der Germanistik im 21. Jahrhundert“ statt.
Fünfundfünfzig geladene Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie rund sechzig Gäste diskutierten auf Podiumsdiskussionen und abseits davon streitbar und produktiv über die Entwicklungen und Perspektiven der Germanistik. Mit rund 80.000 Studierenden ist sie noch immer das größte geisteswissenschaftliche Fach an deutschen Universitäten.
Auf dem Programm des Colloquiums standen sowohl Themen, die eine mehr innerdisziplinäre Bedeutung besitzen, wie auch Themen, die für die gegenwärtige Lage der Geisteswissenschaften insgesamt relevant sind.
Die Sektion A „Nach der Theorie – Methoden und Modelle“ nahm die theoretischen Debatten und Kontroversen der letzten Jahre zum Ausgangspunkt, um nach zukünftigen theoretischen und methodischen Ausrichtungen des Faches zu fragen.
Sektion B „Jenseits von Bologna – Studium und Beruf“ setzte bei der Bologna-Reform und der Kompetenzorientierung in Schule und Studium an. Sie thematisierte die gesellschaftlichen Aufgaben der Germanistik (insbesondere des Studiums), erstens die Lehrerausbildung, zweitens die Perspektiven von Germanistikstudierenden in Ausbildung und Beruf.
In einer zusätzlichen, dritten Diskussionsrunde unter dem Titel „Germanistik und Karriere?“ kamen individuelle Karrierewege außerhalb der Universität zur Sprache. Hier debattierten einige ehemalige Absolventinnen und Absolventen der Germanistik, die mittlerweile in leitenden Funktionen außerhalb der Universität tätig sind, über ihre Erfahrungen mit dem Fach Germanistik.
Gegenstand von Sektion C „Am Ende der Exzellenz – Wissenschaftsbetrieb“ schließlich waren die forschungsstrukturellen und wissenschaftspolitischen Veränderungen der Universitäten insgesamt im Zuge einer verstärkten wettbewerbsorientierten Finanzierung von Forschung. Die Tagung konnte in enger Kooperation mit und dank großzügiger Förderung durch die VolkswagenStiftung realisiert werden.
Die Online-Publikation bietet alle Konferenzbeiträge als Audiomitschnitte. Alle Statements, die den Diskussionen zugrunde lagen, stehen zusätzlich als Textdateien zur Verfügung. Nach der Konferenz erstellte Berichte stellen die debattierten Probleme zusammen und kommentieren sie.